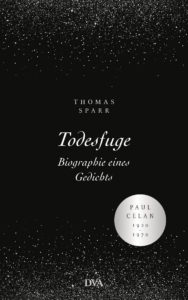Rezension von Oliver Wieters
Thomas Sparr, Todesfuge – Biographie eines Gedichts, München (Deutsche Verlags-Anstalt) 2020
Quelle: Oliver Wieters, „Rezension zu Thomas Sparr: Todesfuge. Biographie eines Gedichts, München 2020“, in: Celan-Perspektiven 2020, hrsg. von Bernd Auerochs, Friederike Felicitas Günther, Markus May, Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2021 (erschienen am 15.3.2021), pp. 243 ff., ISBN: 978-3-8253-4772-7.
Celan-Perspektiven 2020 | Inhaltsverzeichnis
Auch Gedichte haben ihre Schicksale, wie die hier vorgelegte Publikation von Thomas Sparr zeigt. Sein sorgfältig komponiertes und recherchiertes Buch Todesfuge – Biographie eines Gedichts widmet sich einem Jahrhundertgedicht, wie Wolfgang Emmerich es einmal genannt hat: Paul Celans Todesfuge, dem wahrscheinlich bekanntesten (wenn auch keineswegs typischsten) Werk des jüdischen Dichters, der vor hundert Jahren in Czernowitz geboren wurde und vor fünfzig Jahren in Paris aus dem Leben schied. Thomas Sparr, der von 1990 bis 1998 den Jüdischen Verlag im Suhrkamp Verlag leitete und heute als Editor-at-Large für Suhrkamp tätig ist, verzichtet darauf, das Gedicht umfänglich zu interpretieren und richtet sein Hauptaugenmerk auf die Rekonstruktion der Entstehungsbedingungen, der Biographie des Dichters und der Wirkung des Textes. „An jedem Ort dieses Buches“, so Sparr, „in jedem Jahr kehrt die Todesfuge in unterschiedlicher Gestalt wieder: in alter Form, neu verwandelt, als Zitat oder Fragment.“ (S. 255)
Der Autor beklagt, dass das „Ungefähre überwiegt, wenn es um die Entstehung des Textes geht, um seine Wirkung und deren Wandlungen“ (S. 9). Aus diesem Grund widmet er sich zunächst ausführlich der Herkunft Celans, der Geschichte von Celans Heimat und den unmittelbaren Entstehungsbedingungen der Todesfuge. Sparrs Ausführungen über Czernowitz, die ehemalige Hauptstadt des österreichischen Kronlands Bukowina, sind ihm besonders anschaulich gelungen. Sie zeichnen ein plastisches Bild dieser lebendigen, kulturell reichen Stadt, in der vor dem Krieg Juden, Ukrainer, Polen, Rumänen, Armenier und Deutsche zusammen lebten. Heute gehört die Stadt zur Ukraine und versucht, soweit dies möglich ist, an ihre alte Tradition wieder anzuknüpfen, wie Sparr ausführt.
Die Todesfuge ist wahrscheinlich Ende 1944 oder Anfang 1945 in Czernowitz oder wenige Monate später in Bukarest entstanden, wie Barbara Wiedemann dargelegt hat. Im Jahr 1944 hatte Celan vom Tod seiner Eltern erfahren. Sein Vater war 1942 im Lager Michailowka in der Ukraine an Typhus gestorben, seine Mutter im selben Jahr dort erschossen worden. Ende Dezember 1944 las Celan in der russischen Tageszeitung Iswestija einen offiziellen Bericht über das Lemberger Ghetto, in dem das Schicksal der jüdischen Bevölkerung aus propagandistischen Gründen nur am Rande erwähnt wurde. Wann genau Celan das Gedicht geschrieben hat, lässt sich heute nicht mehr sagen, da keine Vorstufen erhalten sind, höchstwahrscheinlich kurz nachdem er den Artikel gelesen hatte. Die Todesfuge erschien 1947 zuerst unter dem Namen Todestango auf Rumänisch. Den Titel hatte Celan dem russischen Bericht entnommen. 1948 fügte Celan das Gedicht seinem kurz darauf zurückgezogenen Band Der Sand aus den Urnen hinzu. 1952 fand es seinen Weg in den Gedichtband Mohn und Gedächtnis. Im gleichen Jahr hat es Celan auf der Tagung der Gruppe 47 zum ersten Mal öffentlich vorgetragen. Seit Anfang der sechziger Jahre stand Celan einem Neuabdruck der Todesfuge ablehnend gegenüber, weil das Gedicht seiner Meinung nach inzwischen „lesebuchreif gedroschen“ worden war. Die „Biographie“ des Gedichts war damit freilich keineswegs abgeschlossen, wie Sparr darlegt. Seit die Todesfuge ins Leben getreten ist, wurde sie laut Sparr als eine Art „Störenfried“ (S. 326) wahrgenommen. Der Verfasser macht deutlich, dass dies nicht nur mit dem Gehalt des Gedichts, sondern auch mit dessen Form und dessen Entstehung zu tun hat. Dabei lassen sich zwei Hauptmotive ausmachen:
- Einerseits gab es in einem großen Teil der deutschen Literaturkritik nach dem Krieg eine Unfähigkeit und Unwilligkeit, den realen Gehalt des Gedichts – die Ermordung der Juden – zur Kenntnis zu nehmen. „Das ‚Grab in der Luft‘“ wie Celan noch 1961 mahnend an Professor Walter Jens schrieb, „das ist, in diesem Gedicht, weiß Gott weder Entlehnung noch Metapher.“ (S. 188) Sparr liefert zahlreiche Belege dafür, dass alle Bildelemente in der Todesfuge eine präzise historische Entsprechung besitzen: Eine Tatsache, die von den Überlebenden als „erschreckende Genauigkeit“ wahrgenommen wurde. Der einflussreiche Kritiker Günter Blöcker bezeichnete die Todesfuge im Berliner Tagesspiegel hingegen als „kontrapunktische Exerzitien auf dem Notenpapier“, fern von jeglichem Wirklichkeitsbezug. Es gab aber auch Ausnahmen. Ludwig von Ficker, der Freund Georg Trakls, war im Jahr 1948 der erste nichtjüdische Kritiker, der auf das Jüdische der Dichtung Celans einging, woran dem jungen Dichter viel gelegen war.
- Andererseits wurde das Gedicht auch von jüdischer Seite als Störenfried wahrgenommen. Celans Weggefährte Alfred Kittner empfand das Gedicht als „allzu kunstvoll, zu vollendet“ (S. 65), gemessen an den Schrecknissen, die ihm und seinen Leidensgefährten zugestoßen waren. Auch der jüdische Schriftsteller Werner Kraft kritisierte 1964 den „verflucht ästhetischen Klang“ des Gedichts, der für ihn „Kitsch“ streifte. Und selbst der Wiener Dichter Erich Fried, für den die Todesfuge „das einzige authentische Gedicht“ im Umfeld der Holocaust-Lyrik war, „in dem das Grauen durch Motivverkettungen, Wiederholungen, hämmernde Daktylen, nie gesehene Bilder eine Form, eine eigene Wirklichkeit gefunden hatte, jenseits jeder Abbildlichkeit“, störte sich an manchen „preziösen“, „erlesenen“ Wörtern und dem vermeintlichen Pathos Celans, wie sich Celans Lektor Klaus Reichert erinnert.[1]
Sparr zeichnet in seinem Buch mit Akribie die Stationen von Celans Leben nach, das den Dichter unter abenteuerlichen Bedingungen von Czernowitz nach Bukarest, Budapest, Wien und schließlich nach Paris führte. Dabei kann er auch auf eigene, vor Ort gesammelte Eindrücke zurückgreifen. Sparr berichtet von Celans zahlreichen Beziehungen zu Frauen, Celans verbittertem Kampf um Anerkennung, seinem Leiden an den bösartigen Plagiatsvorwürfen, die gegen ihn von Claire Goll erhoben wurden – und die Sparr auf abgewiesene Liebe zurückführt –, von Celans finanziellen Problemen und der Sorge um seine stark angegriffene geistige Gesundheit (ein „Kranken an der Wirklichkeit“, wie es Hans Mayer nannte). Celan, das wird deutlich, war ein Mensch, der viele Existenzen nebeneinander leben konnte, wie es einmal Celans Freundin Brigitta Eisenreich ausgedrückt hat. In der 1950 entstandenen Erzählung Die Abreise von Marie Luise Kaschnitz findet die Todesfuge einen ersten literarischen Widerhall in Deutschland. Eine Ausnahme, bis heute.
Für die Rezeption des Gedichts in Deutschland kommt Celans Lesung beim Frühjahrstreffen der Gruppe 47 in Niendorf an der Ostsee zentrale Bedeutung zu. Es wurde oft erzählt, dass Celans Vortrag zu einem „Reinfall“ (Walter Jens) wurde und die Reaktion einiger Teilnehmer Celan tief verletzt habe. Tatsächlich, so Sparr, ist zu vermuten, dass sich einige Zuhörer gegen Celans Vortragsweise wendeten, um nicht über den Inhalt der Gedichte zu sprechen. Celan hatte den Eindruck, einer Versammlung von Leuten beizuwohnen, die sich „bürgerlich mit einer Welt ausgesöhnt hatten, deren Erschütterungen sie immerhin zu spüren bekommen hatten“ (S. 126). Erschwerend für die Rezeption des Gedichtes kam hinzu, dass die deutsche Literaturkritik bis in die 50er Jahre hinein weitgehend von der methodischen Richtung der Werkimmanenz bestimmt war: Kaum einer der Kritiker, von denen viele selbst Schriftsteller waren, fragte nach den Entstehungsbedingungen des Gedichts, über die zudem damals noch wenig bekannt war. Begriffe wie ‚Holocaust‘ und ‚Shoah‘ fanden erst viel später über Fernsehen und Film Eingang in den allgemeinen Diskurs.
Sparr geht in der Folge in der gebotenen Kürze auf die Bedeutung des berühmten Diktums von Adorno ein, der das Gedicht „zu dem machen wird, als das wir es heute wahrnehmen“ (S. 114): „Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch“. Dieser Satz wurde, das kann man so sagen, durch die Todesfuge widerlegt. Sparr wendet sich lieber einigen weniger bekannten Aspekten der Rezeptionsgeschichte zu. Dazu gehört die Aufnahme des Gedichts in den Vereinigten Staaten, wo die Übersetzungen der Todesfuge seit 1955 auf ein interessiertes jüdisches Publikum trifft, das, wie Celan mutmaßte, einen ganz anderen Begriff von ‚Jewishness‘ hatte als er selbst. Dieses interessante Kapitel hätte nach Meinung des Rezensenten ruhig etwas ausführlicher sein können. Ende der 50er Jahre erwacht auch das Interesse von Musikern an dem Gedicht. 1957 nimmt ein junger holländischer Komponist namens Rap Geraedts mit Celan Kontakt auf. Celan steht seinem Vorhaben, die Todesfuge musikalisch umzusetzen, mit gemischten Gefühlen gegenüber. Zur gleichen Zeit findet in deutschen Schulen eine erste Rezeption des Gedichts statt, die, wie Sparr attestiert, zum Teil „von der Einsicht in die historische Realität [zeugt], was die Literaturkritik jener Zeit so gut wie nicht leistete“ (S. 169). Mit einem Blick auf die Rezeption der Todesfuge in der DDR öffnet Sparr den Blick auf eine Wirkungsgeschichte, von der im vereinigten Deutschland nur wenige wissen: Obwohl Celan die DDR mied und er bei den offiziellen Vertretern des autoritären Staats wegen seiner Dunkelheit und seiner Kritik am Stalinismus unbeliebt war, fand sein Gedicht Radix, Matrix Mitte der 80er Jahre Einzug in den Titel und Inhalt der subversiven „Radix-Blätter“. Seine Gedichte wurden in diesem Umkreis offen diskutiert.
Zur Rezeptionsgeschichte des Gedichtes in Deutschland gehört auch die Tatsache, dass die Literaturwissenschaft erst spät nach den genauen Umständen der Verfolgung und Ermordung von Celans Eltern gefragt hat. Die einzige authentische Quelle ist „Das Grab im Kirschgarten“, ein Lager-Tagebuch des Überlebenden Arnold Daghani, der als Arnold Korn in der Bukowina geboren wurde. Es geriet 1960 in die Hände des verdienten Staatsanwalts Fritz Bauer, der Ermittlungen und letztlich eine Reihe von Prozessen in Lübeck initiierte. Die Prozesse führten aber zu keiner Verurteilung. „An keinem anderen Ort, zu keiner anderen Zeit kommen wir den Mördern von Celans Eltern so nahe wie in Lübeck von 1963 bis 1965“, so Sparr. „Die Literaturkritik indessen nahm davon so wenig Kenntnis wie von den Frankfurter Auschwitz-Prozessen, die die Öffentlichkeit damals ebenso intensiv beschäftigten wie die zeitgenössische Literatur.“ (S. 211)
Es waren diese Umstände, die Celan in seiner Auffassung bestärkten, dass die Literaturpreise, die ihm in Deutschland verliehen wurden, letzten Endes nur ein Vorwand waren. 1962 schrieb Celan an seinen Freund Erich Einhorn über die Todesfuge: „Was mir dieses Gedicht – und ähnliche Gedichte – eingetragen haben, ist ein langes Kapitel. Die Literaturpreise, die mir verliehen wurden, dürfen Dich darüber nicht hinwegtäuschen: sie sind letzten Endes nur das Alibi derer, die im Schatten // solcher Alibis mit anderen, zeitgemäßen, Mitteln fortsetzen, was sie unter Hitler begonnen bzw. weitergeführt haben.“ (S. 228). An dieser Stelle hätte Sparr allerdings durchaus die Frage aufwerfen können, warum sich Celan nicht scheute, einen Preis aus der Hand von Repräsentanten wie jenen des Bundesverbandes der Deutschen Industrie entgegenzunehmen, die er zutiefst verabscheute.
Im Herbst 1969, dem Herbst seines kurzen Lebens, reiste Celan nach Jerusalem. Seine Hoffnung, in Israel eine neue Heimat zu finden und auf eine offenere, verständnisvollere Leserschaft zu treffen, erfüllte sich nur zum Teil. In Jerusalem verzichtete er darauf, sein berühmtestes Gedicht vorzutragen. Auf die Euphorie folgte die ernüchternde Einsicht, dass Deutsch in Israel eine fremde (und offiziell unerwünschte) Sprache war und immer fremder zu werden begann. Diese Enttäuschung verband sich mit der Entfremdung, die er in Hinsicht auf seine Freundin Nelly Sachs empfand, deren „angemaßte Stellvertretung“ (S. 221) für das Judentum er zurückwies. Auch die lang erhoffte Begegnung mit Martin Heidegger am 26. März 1970 in Todtnauberg konnte Celans Erwartungen nicht erfüllen.
Achtzehn Jahre nach Celans Tod wurde die Todesfuge anlässlich des 50. Jahrestags der „Reichspogromnacht“ im Bundestag von Ida Ehre vorgetragen. Die Rede von Bundestagspräsident Philipp Jenninger geriet dabei zu einem rhetorischen Desaster und führte zu seinem Rücktritt, obwohl er von Vertretern der jüdischen Gemeinde in Schutz genommen wurde. Seitdem wurde das Gedicht nicht mehr bei offiziellen Veranstaltungen rezitiert – auch dies ein charakteristisches Kapitel der wechselvollen Biographie des Gedichtes. Sparr ist sich dennoch sicher, dass es die Todesfuge auch im nächsten Jahrhundert geben wird. Sie ist, wie Celan einmal gesagt hat, ein „Entwurf kommender Erinnerungen“ (S. 286).

Das Buch geht auf einen Artikel zurück, den Sparr für die von Dan Diner herausgegebene Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur geschrieben hat. Auch im vorliegenden Buch orientiert er sich an Orten und Namen statt an Leitbegriffen. Der Beitrag ist die Frucht einer jahrzehntelangen Beschäftigung mit dem Dichter, die ihren ersten Ausdruck in Sparrs Doktorarbeit über „Celans Poetik des hermetischen Gedichts“ (1989) gefunden hat. Damals hatte sich der junge Literaturwissenschaftler aus Hamburg auf eine Zeichentheorie der Hermetik konzentriert und bei Celan eine Verschiebung auf die Verwendung autonomer Zeichen festgestellt, obwohl Celan den Begriff der Hermetik für seine Dichtung entschieden zurückgewiesen hat. Seitdem hat die Celan-Forschung viel Licht in die Biographie Celans, die vielfältigen Bezüge und die Entstehungsbedingungen seiner Gedichte gebracht (siehe z.B. den Briefwechsel von Ilana Shmueli und Paul Celan, den Sparr mit herausgegeben hat). Trotzdem fühlt sich Sparr, und dies gewiss zu Recht, in seiner damaligen These im Grundsätzlichen betätigt: Celans „Aufzeichnungen über die Dunkelheit des Dichterischen zeigen indes, dass dies eine Abwehr aus der Nähe heraus war.“ (S. 284)
Celan hat davor gewarnt, seine Gedichte auf ihren Anlass zu reduzieren. „Wenn ich anfange, zu erklären, woher etwas kommt […], denkt der Leser, mit diesem ‚Schlüssel‘ habe er das Gedicht verstanden. Das ist aber kein ‚Schlüssel‘. […] Wenn Sie wissen, was das Rosa-Luxemburg-Gedicht ausgelöst hat, ist das Gedicht ja noch nicht ‚verstanden‘. Nein. Jedes Gedicht stellt eine nur ihm eigene Wirklichkeit her, auch wenn es in vielfältigen Bezügen, auch zu anderen Gedichten, steht. Es ist die Opazität, die mir wichtig ist.“[2]
Die Todesfuge ist als Grabschrift und literarisches Grab für seine ermordete Mutter entstanden. Aber Celans Gedichte sind keine Morgue. Sie „sind für die Lebenden geschrieben, allerdings für diejenigen, die der Toten eingedenk bleiben“ wie Celan gegenüber Klaus Reichert insistierte.[3] In seiner Dankesrede für die Verleihung des Bremer Literaturpreises im Jahr 1958 hatte Celan das Gedicht mit einer „Flaschenpost“ verglichen, die auf ein ansprechbares Du zuhält. Sparrs exzellentes Buch, mit einem hilfreichen Literaturverzeichnis, einem Register und einer Zeitleiste, trägt einen guten Teil dazu bei, dass Celans Flaschenpost auch in Zukunft ihren Adressaten findet.
Anmerkungen
- Klaus Reichert, Paul Celan. Erinnerungen und Briefe, Berlin 2020, S. 29. ↑
- Reichert: Paul Celan. Erinnerungen und Briefe, S. 93. ↑
- Ebd., S. 174. ↑
![]()